Einsteins Kühe (3)
Die einstmals übertragenen Funken haben dem Medium auch seinen Namen gegeben. Es heißt immer noch Rundfunk, obwohl längst keine Funken mehr fliegen. Als die Menschen - anders als die verwöhnten Smartphone-Nutzer heute - noch staunen konnten, fragten sich einige von ihnen, wie das sein konnte. Wie gelangen körperlose Stimmen ohne Kabel mittels unsichtbarer Wellen in die Ohren der Menschen in ihren Wohnungen? Anfangs mußten dafür noch Kopfhörer aufgesetzt werden, aber 1925 kam ein elektrodynamischer Lautsprecher auf den Markt, der Zuhörer ohne solche Hilfsmittel mit dem Radio verband. Mit dem Rundfunk gab es das erste Telemedium, in dem sich ein Einzelner als einer medial zustande gekommenen Erlebnisgesellschaft zugehörig betrachten konnte, ein Gefühl, das die Menschen nicht mehr verlassen hat und das heute ganz selbstverständlich geworden ist. Dabei entwickelte sich eine neue Wahrnehmungskultur, zu der auch das Grammophon beitrug, mit dessen Hilfe es im Verlauf des späten 19. Jahrhunderts gelungen war, erst die menschliche Stimme und dann musikalische Klänge zu reproduzieren, die ein akustisches Trägermedium namens Schallplatte mit seinen Rillen gespeichert hatte. Es ist offenkundig: Die Geschichte der Menschen ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch eine Mediengeschichte, die ihrerseits als Geschichte der Techniken erzählt und verstanden werden muß, die der menschlichen Kommunikation dienen. Zu diesen Medien gehörte nach dem Fernsprechen das Fernsehen und nach dem Telefon die Television. In dem Maße, wie die entsprechenden Geräte Bilder zeigen sollten, mußten sie mit Bildschirmen ausgerüstet werden, die seit Anfang der 1970er Jahre die Eigenschaft bekommen haben, sich durch Tasten oder Berühren bedienen zu lassen. Was für Forschungseinrichtungen entwickelt wurde und für Konferenzen vorgesehen war, fand seinen Weg bald in den Alltag.
1992 baute die Firma IBM einen ersten Touchscreen in eines ihrer mobilen Telefone ein.
Der Name Touchscreen verweist auf elektrische Spannungen, die ein Kondensator speichern kann, was die Physiker durch seine Kapazität messen, wie man früher noch in der Schule lernte. Bei den erwähnten Touchscreens kommt eine Glasplatte als Bildschirm zum Einsatz, die mit einem durchsichtigen Metalloxid beschichtet und an der eine elektrische Spannung angelegt ist. Wird die Folie mit einem (leitfähigen) Finger angetippt, wird der Strom an dem Punkt der Berührung unterbrochen. Ladungen geraten in Bewegung, wobei zu dem funktionierenden Gesamtgebilde noch eine Einrichtung namens Controller gehört, die die registrierten physikalischen Informationen aufnimmt und aus ihnen die Position der Berührung berechnet und punktgenau ermittelt.
Beim Sehen im Auge geschieht etwas Vergleichbares. In den lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut fließt ein Strom, solange es dunkel ist. Der Dunkelstrom wird unterbrochen, wenn es im Auge hell wird. Dies führt zu einem elektrischen Signal, das dem Gehirn zugeleitet wird, in dem zuletzt aus dem Licht das Sehen wird. Ein Wunder, keine Frage, aber trotzdem ohne Erlebnisverlust aufzulösen in eine Kette von Signalen, ganz wie die Magie der Touchscreens. Steckt vielleicht in der Erklärbarkeit der magisch wirkenden Dinge das eigentliche Wunder? «Das Unbegreifliche an der Welt [der Natur und der Technik] ist ihre Begreiflichkeit», hat Albert Einstein gemeint, der jeden Philosophen ausgelacht hätte, der ihm etwas von der «Entzauberung der Welt» erklären wollte und nicht einmal zu sagen wußte, wie eine Straßenbahn losfährt.
Der amerikanische Autor Arthur C. Clarke hat einmal bemerkt, daß fortschrittliche Technologien von einem gewissen Grad an von Magie nicht zu unterscheiden sind. Beim Touchscreen ist ein solcher Grad erreicht. Das sollte aber niemanden daran hindern, sich über das Zusammenspiel von mechanischer Berührung mit elektrischen Signalen und mathematischen Berechnungen erst zu wundern und dann genauer zu informieren. Auch dieses Wechselspiel funktioniert bereits in der Natur. Treffen zum Beispiel Pantoffeltierchen auf ein Hindernis, sorgt der Aufprall dafür, daß winzige elektrische Ströme in ihren Härchen die Richtung umkehren. Der Vorgang erlaubt den Zellen, sofort den Rückwärtsgang einzulegen, und dem Pantoffeltierchen, ins Freie zu entkommen, wo es leben kann und möchte. Das Wunder der Signalumwandlung - es funktioniert im Leben wie im Smartphone, und der Versuch lohnt sich, mit seiner Hilfe die Abläufe der Welt zu verstehen.
- Finis -
aus: „Warum funkeln die Sterne?“
Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt
© 2023 C.H. Beck
Veröffentlichung in den Musenblättern mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
|
Einsteins Kühe (3)
von Ernst Peter Fischer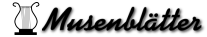

Das Feuilleton
26.10.25
