Von den Atomen zu den Genen (2)
Im heutigen Sprachgebrauch tritt an die Stelle des funktionalen Gens der Name des biochemischen Moleküls, aus dem das Erbgut besteht. Oftmals kann man Sätze hören oder lesen wie: «Das gehört zu meiner DNA.» Der Sprachgebrauch geht längst so weit, daß Fußballvereine von ihrer Club-DNA, Ministerien von ihrer Gerechtigkeits-DNA und Kulturkritiker von der DNA der Schriften von Rudolf Steiner sprechen, womit sie vielleicht der alten Redeweise «Das liegt jemandem im Blut» eine neue Form geben wollen. Aber auch wenn Spieler und Beamte Menschen mit DNA sind, Clubs, Behörden und Schriftstücke weisen weder Blut noch Erbmoleküle auf.
DNA kürzt das lange Wort Desoxyribonukleinsäure ab - hinter dem A verbirgt sich das englische «acid», das für die deutsche Säure steht. Mit den drei Buchstaben wird die Sorte aus Kernsäuren bezeichnet, die Erbinformation speichern kann. Gene bestehen aus DNA. lm Verlauf eines Lebens können einzelne Stücke aus DNA unterschiedlich kombiniert und neu zusammengesetzt werden. Neugeborene Menschen verfügen noch nicht über alle Gene, die sie zum Leben brauchen und dafür auch bekommen - eine bemerkenswerte Einsicht. Sie müssen sich ihr Genom erst im Laufe ihres Heranwachsens herstellen, und in diesen Prozessen verbergen sich erstaunliche Geheimnisse von Organismen und ihrer Entwicklung.
Die Frage «Wie viele Gene hat ein Mensch?» ist also nur scheinbar einfach; jetzt zeigt sich, wo die Schwierigkeiten ihrer Beantwortung stecken. Meint man die Menge der in einer bestimmten Zelle vorhandenen und aktiven Gene? Oder meint man die Zahl der durch Umgruppierung von DNA-Abschnitten möglichen Gene mit ihren sich ändernden Informationen? Um so präzise wie möglich festzulegen, was ein Gen ist und was dazugezählt werden kann, orientiert man sich an dem Konzept, daß Gene die Informationen enthalten, die eine Zelle zum Bau von Proteinen benötigt. Proteine sind große Moleküle, die aus Ketten von kleineren gebildet werden - sie heißen in der Biochemie Aminosäuren. Die Information in der DNA legt die Reihenfolge der Bausteine in einem Protein fest. In einer Zelle nimmt diese molekulare Kette eine elegante Struktur an, um damit anschließend die chemischen Reaktionen katalysieren zu können, die zum Leben beitragen und von Zellen benötigt werden, wenn sie wachsen, Stoffwechsel treiben und auf die Umwelt reagieren wollen. Ein Gen sorgt für ein Protein, und wenn auch unklar bleibt, wie diese Definition über eine Funktion es erlaubt, die Zahl der DNA-Abschnitte zu ermitteln, deren Information zu einer Proteinkette wird - Lehrbücher und Lexika zögern an dieser Stelle nicht, eine Zahl zu nennen: Ein Mensch gemeint ist eine menschliche Zelle - hat danach «ungefähr etwa» 25.000 Gene. «Ungefähr etwa» - «der Kasus macht mich lachen», wie Goethes Doktor Faust an dieser Stelle kommentiert hätte, den es noch mehr amüsieren würde, könnte man ihm die Vorschläge aus jüngster Zeit vorlegen, bei denen Genetiker ernsthaft von exakt 21.306 Genen sprechen, die für Proteine zuständig sind, und denen sie ebenso exakt 21.856 Gene an die Seite stellen, die etwas anderes machen sollen (ohne daß man erfährt, was genau sie im Leben zu schaffen haben). Immerhin geben die Experten keine Stelle hinter einem Komma an, und sie sagen auch nicht, von welcher Zelle sie sprechen. Mit anderen Worten, auf die Frage «Wie viele Gene hat ein Mensch?“ kann man nur antworten, daß man deren Zahl so wenig kennt wie die Antwort auf das Sorites-Problem, in dem das griechische «sorós» für «Haufen» steckt und in dem es darum geht, zu sagen, wann eine Menge von Reiskörnern oder Erbsen als Haufen bezeichnet werden kann. Vielleicht sollte man sich mit der Auskunft bescheiden, daß Menschen - und nicht nur sie ~ einen Haufen Gene haben, mit dem sie ihr Leben führen müssen.
Die auch bei allem Witz immer noch lächerlich klein wirkenden Zahlen für den humanen Haufen - der gemeine Wasserfloh und ein Fadenwurm weisen mehr Gene als ein Mensch auf- lassen nur auf eines sicher schließen. Gemeint ist, daß die Raffinesse des menschlichen Wesens und die Komplexität des Homo sapiens nicht durch die Menge seiner genetischen Anlagen zu erklären sind. Wodurch denn dann? - so wird sofort gefragt werden, und die Antwort könnte in der Kombinationsfähigkeit der menschlichen Gene liegen. Wenn in einer Zelle DNA-Stücke aus dem Erbgut ausgeschnitten und an anderer Stelle eingefügt werden, geht das nicht ohne die Hilfe der Proteine vonstatten, die oben allgemein als die Katalysatoren der Zelle vorgestellt worden sind. Für sie aber muß es Gene geben, was zu der rätselhaften Erkenntnis führt, daß es Gene geben muß, die für Gene sorgen. Es ist hier nicht der Platz, um alle Verästelungen der modernen Biologie nachzuzeichnen. Aber es gilt, schlicht zur Kenntnis zu nehmen, daß es zwar ein Humanes Genomprojekt gegeben hat, daß dabei aber an dessen Ende vor allem klar wurde, daß es das ursprüngliche Objekt der Forscherbegierde gar nicht gibt. Es gibt kein stabiles Genom, das man als Bild präsentieren kann. Das menschliche Erbgut ist von verwirrender Instabilität, und es ist fast unmöglich, hier nicht aus Goethes Faust zu zitieren:
Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszutreiben;
Dann hat er die Teile in der Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.
Tatsächlich - der Genomforschung ist das geistige Band entglitten, und die Lage wird nicht besser mit den immer schneller arbeitenden Sequenzierautomaten und den dramatisch zunehmenden genetischen Dateien. Immerhin hat sich in der Datenfülle gezeigt, daß Gene nicht nur neu zusammengesetzt werden, sondern auch springen können, und sie hüpfen vor allem in den Stammzellen umher, aus denen die Neuronen werden sollen, die Aufgaben im menschlichen Gehirn übernehmen und für die Signale zuständig sind, die das Verhalten eines Menschen bewerkstelligen oder koordinieren. Die Zellen des Gehirns, die Neuronen, führen ihr Leben mit genetischen Flickenteppichen, das ganze Denkorgan operiert mit einem gigantischen Patchwork aus DNA-Stücken. Dies bedeutet positiv formuliert: Es sind individuelle Veränderungen im Genom von Neuronen, mit denen die Vielfalt entstehen kann, die Menschen auf wundersame Weise in die Lage versetzt, auf die ununterbrochen auf sie einstürzenden mannigfaltigen Änderungen ihrer Umwelt zu reagieren. Es gibt nicht ein Humangenom, es gibt Milliarden Humangenome, ein anderes und eigenes in jeder Hirnzelle. Niemand aber versteht genau, was da los ist und was diese Flexibilität bedeutet. Nur eines ist klar: So, wie Gene nicht etwas Bestimmtes sind, sondern immer etwas anderes werden, so kann man Leben auch nicht als etwas verstehen, das vor einem steht und da ist, sondern nur als etwas, das sich in der Welt entfaltet und seinen Ort sucht. Nichts ist gesetzt - wie ein Gesetz -, alles ist (in genetischer) Bewegung, und der mobilste Teil des Menschen steckt in dem Nervengewebe unter der Schädeldecke, das Gehirn genannt wird. Ihm gehören die nächsten Abschnitte dieses Kapitels, und vielleicht läßt sich mit seiner neurologischen Hilfe die genetisch nicht zu klärende Frage beantworten, was dem Menschen seine herausragende Stellung in cler Natur verschafft hat.
aus: „Warum funkeln die Sterne?“
Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt
© 2023 C.H. Beck
Veröffentlichung in den Musenblättern mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
|
Von den Atomen zu den Genen (2)
von Ernst Peter Fischer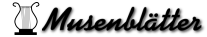

Das Feuilleton
07.09.25
