Von den Atomen zu den Genen (1)
Als 1945 die ersten Atombomben ihre Zerstörungskraft demonstrierten, wandten sich viele Physiker von ihrer angestammten Disziplin ab. Im Anschluß an den Zweiten Weltkrieg suchten sie nach neuen und harmlos scheinenden Herausforderungen in der ihnen ach so friedlich erscheinenden Biologie. Nach den Atomen wendeten sich viele von ihnen den Genen zu, wobei sie dafür ein großes Vorbild anführen konnten. Denn wenn man fragt, wie es kommt, daß ausgerechnet ein Mönch - gemeint ist der Augustinermönch Gregor Mendel - im 19. Jahrhundert die ersten Gesetze der Vererbung entdeckt hat, erfährt man, daß Mendel von seinem Kloster zum Physikstudium nach Wien geschickt worden war, um Lehrer für dieses Fach zu werden. (Daß ein Kloster Physikunterricht anbieten wollte, hat mit seiner Rolle als Bildungsstätte zu tun, die staatliche Schulen damals nicht übernehmen konnten.) Nachdem Bruder Mendel an den erforderlichen Examina gescheitert war - er scheint unter Prüfungsangst gelitten zu haben -, wies der Klosterabt ihm Aufgaben im Garten zu, und hier suchte der kommende Vater der Genetik in Pflanzen nach dem, was die Physiker in Gasen als Atome gefunden hatten, wie er an der Universität gelernt hatte. Mendel sprach von biologischen Erbelementen, die dem Leben seine Eigenschaften vermittelten, wie es die Atome bei der toten Materie vermochten. Der Mönch verfolgte bei den Erbsen in seinem Klostergarten quantitativ die Weitergabe von vererbbaren Eigenschaften an nachfolgende Generationen und bescherte auf diese Weise mit seinen Zahlen den physikalisch orientierten Lebenswissenschaftlern im 20. Jahrhundert die Möglichkeit, sich näher um die Gene zu kümmern, wie die von Mendel beschriebenen Atome der Vererbung seit 1909 heißen. Nach 1945 dann wollten die Physiker genauer herausfinden: «Was ist ein Gen?», und sie versuchten zu verstehen: «Wie bringen Gene das Leben hervor?“
Wer wissen will, was Mendels entscheidende Neuerung beim Betrachten der Vererbung von Eigenschaften war, kann das in einem Satz erfahren. Vor Mendel hatten die Botaniker an einer Pflanze viele Merkmale studiert. Mendel kam auf die Idee, den Spieß umzudrehen und an vielen Gewächsen nur jeweils eine Eigenschaft ins Visier zu nehmen. Dabei sind die statistischen Regeln entstanden, die seinen Namen tragen und die noch heute in den Schulen zum Verdruss der Schülerinnen und Schüler gepaukt werden.
Als die Physiker nach 1945 in die Biologie drängten und vor allem wissen wollten: «Was ist ein Gen?», hätten sie nicht gedacht, daß man dies im 21. Jahrhundert immer noch - oder jetzt erst recht? - ausweichend beantworten muß. Im Jahr 2014 ist ein lesenswertes Buch erschienen, das provozierend über 300 Seiten lang nach dem Gegenteil fragt und wissen will: «Was sind Gene nicht?“ Die für viele sicher überraschende Antwort lautet in ihrer knappsten Version, daß Gene nicht etwas sind, über das Zellen oder die aus ihnen bestehenden Organismen verfügen. Gene liegen nicht als ein stabiles Stück des Erbmaterials vor, das Zellkerne, in Chromosomen verpackt, beherbergen und einsetzen. Gene müssen vielmehr aus vielen im Erbgut verteilten Stücken zusammengesetzt werden, was sie weniger als Ding und mehr als Prozeß erscheinen läßt. Im Kern «genen» die Gene, wie sich sagen läßt, was so ungewöhnlich nicht ist, denn schließlich gilt auch, daß Lehrer lehren und Dichterinnen dichten. Mit dem Verb fällt darüber hinaus der merkwürdige Gedanke leichter, daß ein Menschengen, das man in eine Mauszelle überträgt, dort wie ein Mausgen zu wirken beginnt. Das heißt, die tierische Zelle wird wegen der humanen Erbinformation nicht menschlich, nur ihr Stoffwechsel bekommt eine neue Komponente, und ein Menschengen agiert eher genetisch als menschlich.
Wegen dieser inhärenten Dynamik bereitet die Antwort auf die Frage «Wie viele Gene hat ein Mensch?» große Schwierigkeiten. Sie ist noch schwerer zu klären als die scheinbar identische Frage: «Wie viele Gene finden sich in einer menschlichen Zelle?», an der man ebenfalls herumrätselt. Ein Unterschied zwischen beiden Formulierungen steckt darin, daß ein Mensch nicht nur die eigenen Gene aus jeder seiner Milliarden Zellen mit sich trägt, sondern sein Körper in Gestalt von Bakterien, Viren und Pilzen mit mehr fremden als eigenen Genen versorgt ist. Die Gesamtheit der Mikroorganismen auf einem Lebewesen nennt man sein Mikrobiom. Bei einem Menschen macht dieses organische Material ein Kilogramm an Biomasse aus. Insgesamt scheinen sich im humanen Mikrobiom viele Millionen von Genen zu finden und ihre Wirkung zu entfalten. Die Zahl, die für das Humangenom in einer menschlichen Zelle ausfindig gemacht werden konnte, ist verschwindend gering. Sie liegt knapp über 22.000, was eine Menge Fragen mit sich bringt.
1985 hatten Molekularbiologen das Humane Genomprojekt konzipiert, dessen Ziel darin bestand, die Sequenz der menschlichen Gene offenzulegen. Das Wort Genom meint die Gesamtheit der Gene eines Organismus, und von der wußte man, daß sie in menschlichen Zellen aus drei Milliarden chemischen Einheiten bestehen würde. Sie werden als Buchstaben des genetischen Alphabets bezeichnet, da in ihrer Abfolge die biologische Information steckt, mit der das Leben sich baut und erhält. Stellt man die zunächst einfachere Frage, wer den Text der Gene überhaupt lesen kann, erfährt man, daß die dazugehörigen Daten in einem Computer gespeichert werden und man die Lektüre Maschinen überlassen muß. Und weitergefragt: Was erhofften und erhoffen sich die Wissenschaftler von den Informationen aus dem Genomprojekt? Was wollten und wollen sie mit seiner Hilfe lernen?
Als das Großprojekt konzipiert wurde, war es gerade gelungen, Krebs als genetische Krankheit zu verstehen. Das kann man staunend zur Kenntnis nehmen, aber auch in die Frage verwandeln, wie es möglich ist, daß Gene Ursachen für Krankheiten liefern. Auch wenn sehr viel von «Genen für Krankheiten» die Rede ist, weiß doch die Biologie mit ihrem Gedanken der Evolution, daß die Natur ihre Organismen nicht mit Elementen der Schwächung, sondern im Gegenteil mit vererbbaren Fähigkeiten zum kraftvollen Überleben ausstatten muß. «Gene für Gesundheit» müsste es geben - aber warum ist davon im Allgemeinen nie die Rede?
Eine Antwort steckt in dem oft unbeachtet bleibenden Sachverhalt, daß eine Wissenschaft ein Objekt für ihre Untersuchungen braucht, und im Gegensatz zur Gesundheit ist eine Krankheit genau das. Deshalb ist die Medizin die Wissenschaft von Verletzungen, Darmstörungen, Krebsgeschwüren und anderen Unpässlichkeiten - und nicht die Wissenschaft von der Gesundheit. Während sich Krankheiten zeigen, bleibt die Gesundheit im Verborgenen. Man ist gesund, wenn die Organe schweigen und einen nichts stört. Was soll ein Forscher da suchen oder eine Forscherin untersuchen? Und wer zahlt dafür? Deshalb finden Genetiker zumeist Gene für Krankheiten wie Immunschwächen, Sehstörungen, Krebs oder Haarausfall und weniger Erbelemente für das gute Lebensgefühl, das mit der Gesundheit verbunden ist und Menschen stark macht, also Gene für das unbehinderte körperliche und geistige Wohlbefinden.
Allerdings ist in mindestens einem Fall die Erklärung von Genen für eine Krankheit subtiler. Gemeint ist die Sichelzellenanämie, die so heißt, weil die Blutzellen der Betroffenen ihre normale runde Form aufgeben und wie Sicheln aussehen. Der Unterschied hängt von der Struktur eines einzigen Gens ab, und man kann gut erklären, warum die krankmachende Variante existiert. Menschliche Zellen verfügen über zwei Kopien eines Gens, und so gibt es Menschen, die eine normale und eine mutierte Form der Erbinformation in sich tragen, die zur Herstellung des Hämoglobins eingesetzt wird, wie der rote Blutfarbstoff in der Biochemie heißt. Das Gute an dieser Situation besteht darin, daß diese Menschen mit einem abweichenden Gen vor der gefährlichen Infektionskrankheit mit Namen Malaria geschützt sind. Wenn man sagt, daß es Gene für Malaria gibt, dann meint man, daß Menschen, deren beide Genkopien die krankmachende Version aufweisen, nach einer Übertragung des Erregers erkranken, woran 2015 immerhin mehr als 400.000 Betroffene gestorben sind. Der Trick der Natur besteht darin, viele Menschen mit einem normal funktionierenden Gen und einer Sichelzellenvariante vor Malaria schützen zu können - und deren Zahl ist viel größer. Offenbar hat die Evolution kein Mittel finden können, um alle Menschen vor den Folgen des Mückenstichs zu schützen, aber sie hat wenigstens hinbekommen, eine Vielzahl zu retten. Mit dieser Geschichte ist die Frage, warum es Gene gibt, die zum Krebs beitragen, zwar nicht beantwortet, aber es gilt zu verstehen, daß im Leben immer viele Aspekte im Blick zu behalten sind. So schrecklich Krebszellen für einen Menschen sein können, sie selbst machen nur, was alle Zellen können, das heißt, sie teilen sich und suchen nach Energie für ihr Tun. Alle Zellen müssen eine genetisch vermittelte Grundfähigkeit haben, weil sonst Leben nicht funktionieren könnte.
Teil 2 am kommenden Sonntag!
aus: „Warum funkeln die Sterne?“
Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt
© 2023 C.H. Beck
Veröffentlichung in den Musenblättern mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
|
Von den Atomen zu den Genen (1)
von Ernst Peter Fischer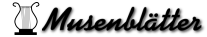

Das Feuilleton
31.08.25
