Einige Schlüsselprobleme
Als der russische Physiker Witali L. Ginzburg, der für seine Arbeiten zur Supraleitung 2003 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, etwa gleichzeitig mit der erwähnten unerfüllten Prognose des amerikanischen Energieministeriums ein (auf Russisch verfaßtes und nicht auf Deutsch erschienenes) Buch über Schlüsselprobleme in Physik und Astrophysik vorlegte, ging er in seinem ersten Kapitel auf «Die kontrollierte thermonukleare Fusion» ein, die ihm in weiter Ferne zu liegen schien. Ginzburg erinnerte sich und sein Publikum an die berühmte Fehleinschätzung, die der Nobelpreisträger Ernest Rutherford 1933 abgegeben hatte, als er lässig meinte, «all talk of using nuclear energy is moonshine» - wer die Nutzung von Kernenergie ankündigt, rede Unsinn. Das stimmte nur, bis 1938 in Berlin die Entdeckung der Kernspaltung gelang und 1942 der erste Reaktor in Chicago auf Probe anlaufen konnte. So spannend Ginzburgs Buch auch ist, an dieser Stelle gilt es erst recht, an Karl Valentins Diktum zu erinnern, daß Prognosen dann besonders schwierig sind, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hätte niemand gedacht, daß man etwas mit Halbleitern anfangen könnte, die inzwischen aus dem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Ohne sie könnte es die digitale Welt, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, nicht einmal im Ansatz geben.
Zu den weiteren Schlüsselproblemen seiner Wissenschaft zählte Ginzburg die Frage, ob es die Gravitationswellen gibt, deren Existenz Einstein bereits 1916 vorhergesagt hat und bei der durch eine beschleunigte Masse eine dynamische Änderung der Raumzeit bewirkt werden soll, die sich wellenartig im Kosmos ausbreitet. Einhundert Jahre nach Einsteins Überlegungen konnten Astrophysiker diese Schwerkraftwellen mit höchst empfindlichen Lasern aufspüren, wobei sie der erstaunten Welt mitteilen ließen, daß die registrierten Gravitationswellen durch den Zusammenstoß zweier Schwarzer Löcher auf ihren Weg gebracht worden waren. Warum hat das so lange gedauert, vor allem, wenn man bedenkt, daß Ginzburg bereits in den 1970er Jahren seine Kollegen bedrängt hat, nach Einsteins Wellen im Weltraum zu suchen. Die Gravitation war zwar die erste Kraft, die Physiker identifizieren konnten - durch Newton im späten 17. Jahrhundert -, sie ist aber die letzte, die von ihnen verstanden wird, oder besser - noch immer nicht verstanden worden ist.
Nicht nur der Nachweis von Gravitationswellen hat sich lange Zeit hingezogen. Auch die Laser, die dazu eingesetzt wurden, hat Einstein in theoretischen Überlegungen bereits 1916 als Möglichkeit der Bündelung von Lichtstrahlen beschrieben, und dann hat es trotzdem bis 1960 gedauert, bevor eine erste solche Apparatur rot aufleuchtete. Der Name Laser ist aus der Abkürzung L.A. S. E. R. hervorgegangen, hinter der sich der technische Ausdruck «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» verbirgt, was auf Deutsch mit «Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung» übersetzt werden kann. Der Clou steckt in dem Wort «stimuliert». Einstein war 1916 aufgefallen, daß die Quantentheorie, die damals noch in ihren Anfängen steckte, einen Weg erkennen ließ, der es erlaubte, Atome durch Energiezufuhr in ein und denselben angeregten Zustand zu versetzen, sie also zu stimulieren. Wenn sie die dabei erreichte Erscheinungsform nun mit einem Mal aufgeben und alle zusammen ihre Energie freilassen, bringen sie den stark gebündelten Lichtstrahl zustande, der im Handel als Laser angeboten und gerne als Pointer verwendet wird.
Niemand zweifelt an der Nützlichkeit des Lasers sowohl im Bereich der Medizin als beispielsweise auch bei der Blechverarbeitung. Warum dauerte es dann durchweg so lange, bis Einsteins Ideen Folgen in der Wirklichkeit zeigten und die Forscher den staunenden Menschen Laserlicht, Kernenergie und Gravitationswellen präsentieren konnten?
Im Fall der Atomenergie kann man antworten, daß die Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts keinerlei Vorstellung davon hatten, wie Atome aufgebaut sind. Einsteins Formel war ursprünglich sogar andersherum konzipiert. In seiner Arbeit von 1905 erkannte Einstein, daß sich die Masse eines Körpers - es geht, physikalisch genauer, um seine Trägheit - mit seiner Energie ändert, und zwar nach der Gleichung m = E/c². Es kam Einstein nicht auf die Freisetzung von Energie an - E = mc² -, und die Physiker seiner Zeit wußten auch nicht, wie sie das bewerkstelligen konnten, aber ein Dichter hatte eine Idee. In seinem 1914 erschienenen Science-Fiction-Roman The World Set Free (Die befreite Welt) stellte sich der englische Autor H. G. Wells vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen der Physik mit ihren radioaktiven Strahlen und Einsteins Formel vor, daß sich eines Tages «Atoınbomben» bauen lassen würden, mit denen man - in des Dichters Phantasie - viel Platz auf der Welt schaffen könnte. Als Physikerinnen wie Lise Meitner und Chemiker wie Otto Hahn 1938 die Kernspaltung am Beispiel des Urans nachweisen konnten und der kurz danach beginnende Zweite Weltkrieg in den USA die Entwicklung einer 1945 erfolgreich gezündeten Kernwaffe in Gang setzte, wollten die Physiker ihr Werk erst als Uranbombe beschreiben. Doch ein Schriftsteller hatte längst das bessere und einprägsamere Wort gefunden, das alle Welt bis heute verwendet.
Die Antwort auf die Frage «Wer hat die Atombombe erfunden?» lautete also etwas unerwartet, daß dies ein Dichter war, der die Welt befreien wollte. Wer wissen will, welcher Wissenschaftler als Erster wußte, daß man die Kernkraft nicht nur in seiner Phantasie nutzen, sondern produzieren kann, muß den Satz umformulieren, ihm eine weibliche Form geben und fragen, welche Physikerin als Erste verstanden hat, daß bei der Spaltung von Uran ausreichend Energie frei wird, um sie als neuartiges Mittel zur Zerstörung einzusetzen. Gemeint ist Lise Meitner, die als Wiener Jüdin Deutschland 1938 verlassen mußte und nach Schweden emigrierte, wo sie zu Weihnachten Post aus Berlin bekam. In dem Schreiben teilte ihr Otto Hahn seine Beobachtung mit, daß Uranatome platzen, wenn man sie mit Neutronen beschießt, und er fügte hinzu, daß er das nicht verstehen könne. Aus dem Uran sei Barium geworden, wie Hahn präzisierte und was Lise Meitner die entscheidende Einsicht ermöglichte. Wenn Uran zu Barium wird, so konnte sie ausrechnen, geht etwas Masse verloren, und die konnte nur als Energie freigesetzt werden, wie Einsteins Formel es angab. Da die Physiker zusätzlich wußten, daß dann, wenn Neutronen Uranatome spalten, weitere Neutronen auftauchen, konnte man sich den Ablauf dessen vorstellen, was heute als Kettenreaktion bekannt ist. Sie tritt ein, wenn die frei werdenden Neutronen weitere Uranatome treffen, dabei weitere Neutronen generieren, die weitere Uranatome treffen, und so weiter, bis die frei gewordene Energie gigantische Ausmaße annimmt und sich blitzartig in einer Explosion zu erkennen gibt. Die «Atompilze», die nach der Zündung von Kernwaffen sichtbar werden, haben mit der enormen Hitze zu tun, die mit Atombomben einhergeht und allgemein die Eigenschaft hat, aufzusteigen, während kalte Luft absinkt (weil sie dichter und damit schwerer als warme ist). Der Atompilz entwickelt sich so heftig, daß er Staub und Asche mit sich reißt und das entsteht, was Physiker Strömungstransport oder Konvektion nennen. Diese wirkt auch, wenn feuchte Luft aufsteigt und zu Wolkenbildungen führt, denen ein Gewitter folgt. Auch die atomare Wolke kann abregnen.
Alles das war nicht absehbar, als Lise Meitners Einsicht den Weg zur Nutzung der Kernenergie frei machte. Wissenschaft kann keine Zukunft vorhersagen, selbst wenn Menschen dies möchten. Anzumerken ist, daß Rutherford leider bereits 1937 im Jahr vor der Entdeckung der Kernspaltung - gestorben war und demnach keinen Kommentar mehr zu seiner oben zitierten dramatischen Fehleinschätzung geben konnte. Eigentlich schade, denn er konnte sich deutlich und drastisch äußern, etwa wenn er meinte, es gebe neben der Physik keine andere Wissenschaft. Alles andere sei Briefmarkensammeln, meinte Rutherford, dem vielleicht genau deshalb der Nobelpreis für Chemie verliehen wurde.
aus: „Warum funkeln die Sterne?“
Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt
© 2023 C.H. Beck
Veröffentlichung in den Musenblättern mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
|
Einige Schlüsselprobleme
von Ernst Peter Fischer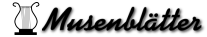

Das Feuilleton
24.08.25
