Vom freien Fall
Warum fallen Dinge überhaupt nach unten? Das wollte schon der große Aristoteles wissen, der, wie wir bereits gesehen haben, nicht nach einer kausalen Erklärung suchte und sich vielmehr mit dem Gedanken beruhigte, daß die Gegenstände zu Boden fallen, weil dort der Platz ist, an den sie gehören und zu dem sie wollen, so wie Menschen in ein Bett fallen, wenn sie müde sind und die Schlafenszeit gekommen ist. Der antike Philosoph dachte darüber hinaus, daß das Gewicht der Körper ihre Fallgeschwindigkeit beeinflußt - je schwerer, desto schneller, wie er mehr oder weniger intuitiv annahm, wobei es nicht lange dauerte, bis dieser Ansicht widersprochen wurde, und zwar bereits vor Christi Geburt. Es war der römische Dichter Lukrez, der als Erster darauf hinwies, daß beim Fallen in der realen Welt die Luft eine Rolle spielt, und sie findet bei schaukelnden Federn mehr Angriffsfläche als bei purzelnden Steinchen. Doch der Irrtum des Griechen hielt sich hartnäckig, was die Frage erlaubt: Warum erweisen sich Dummheiten oft als langlebiger als richtige Einsichten? Selbst Galileo Galilei war als junger Mann vor 1600 noch der Ansicht, «wenn man eine Kugel von Blei und eine von Holz von einem hohen Turm fallen läßt, bewegt sich das Blei weit voraus», was aber falsch ist, wie man sieht, wenn man es ausprobiert. Ein paar Jahrzehnte (!) später konstatierte der reifere Galilei nach reiflicher Überlegung, «daß alle Stoffe mit derselben Geschwindigkeit fallen», was tatsächlich zutrifft, aber sowohl den Mann aus Florenz als auch viele andere Menschen in Erklärungsnot stürzt. Warum fallen eine schwere Eisenkugel und eine leichte Daunenfeder im Vakuum gleich schnell? Und warum ist das so schwer zu verstehen?
Menschen verfügen über einen Common Sense und damit über intuitive Möglichkeiten, Verhaltensweisen von physikalischen Objekten auf direkte Weise zu verstehen. Mit diesem Verfahren kommen sie im Leben gut zurecht, zum Beispiel, wenn sie abschätzen sollen, wie groß ihre Geschwindigkeit ist, wenn sie in einem Zug zur Toilette gehen. Wenn sich ein ICE mit 200 km/ h einem Ziel nähert und man selbst mit 5 km/ h in Fahrtrichtung dem WC zustrebt, ist man insgesamt mit 205 km/ h unterwegs und auf dem Weg zurück zum Platz mit 195 km/ h -, wie man durch konkrete Operationen im Kopf leicht berechnen kann. Das stimmt - wenigstens ungefähr - in der Eisenbahn und bei alltäglichen Geschwindigkeiten. Doch das stimmt überhaupt nicht mehr, wenn das Licht mit seinen 300 000 km/sec (!) ins Spiel kommt, was ungefähr eine Milliarde Kilometer pro Stunde. Wenn ein Fahrgast in einem ICE bei seinem Gang zur Toilette eine Lampe einschaltet, saust das Licht mit derselben unvorstellbaren Geschwindigkeit durch den Gang, die es in einem stehenden Zug oder auf dem Bahnhof haben würde. Das leuchtet einem nicht unmittelbar ein. Es ist antiintuitiv, aber trotzdem richtig, und ausgefeilte physikalische Experimente bestätigen diesen Sachverhalt einer konstanten Lichtgeschwindigkeit, auf den Albert Einstein im Rahmen seiner Speziellen Relativitätstheorie gestoßen ist. Er wollte die Bewegung von materiellen Partikeln und immateriellem Licht widerspruchsfrei beschreiben können, und das ging nur, wenn dessen Geschwindigkeit erstens konstant ist und zweitens eine obere Grenze darstellt.
Als Folge dieser Feststellung mußte Einstein zulassen, daß die für eine bewegte Beobachterin vergehende Zeit verschieden ist von der, die für einen ruhenden Beobachter abläuft. Der große Physiker Werner Heisenberg hat das mit dem Satz kommentiert, er könne einen solchen Befund nur mit seinem mathematisch talentierten Kopf, aber nicht mit seinem Herzen verstehen. Der gesunde Menschenverstand kommt bei diesen Größenordnungen nicht mehr mit. Allgemein läßt sich sagen, daß sich der Common Sense an dem orientiert, was man sinnlich im Normalfall zu fassen bekommt. Die Lichtgeschwindigkeit gehört ebenso wenig dazu wie die Kraft, die Körper dazu bringt, gleich schnell zur Erde zu fallen.
Im Alltag zu Hause fallen Blätter offenbar langsamer als Löffel zu Boden, und so schließt der Hausverstand, was bei Aristoteles zu lesen ist, auch wenn es nicht zutrifft. Als sich Galilei überlegte, was passiert, wenn man zwei Kugeln verbindet, konnte er keinen Grund finden, warum sie zusammen schneller fallen würden. Woher sollte die für solch eine Beschleunigung nötige zusätzliche Kraft kommen? Es gibt in diesem Fall nur die eine Kraft, die heute Schwerkraft heißt. Dieses Gedankenexperiment befreite Galilei von der Notwendigkeit, auf den schiefen Turm von Pisa zu steigen, um das Fallgesetz richtig hinzubekommen - auch wenn das eine schöne Geschichte ist und man sich durch die Tatsache, daß sie sich nicht ereignet hat, nicht davon abbringen lassen muß, sie zu erzählen.
Die erste kausale Erklärung des freien Falls stammt von Isaac Newton, der im 17. Jahrhundert die Idee der Gravitation hatte, aber sofort sah, daß mit dieser einen Antwort viele neue Fragen auftauchen. Was genau ist diese Schwerkraft? Wie bewegt sie sich durch den Raum, und wie kommt sie von der Erdoberfläche ausgehend zu dem Apfel, der sich von einem Zweig löst und zu Boden fällt? Wie kann überhaupt eine Masse - die der Erde - zu einer Kraft werden?
Vorschläge für Antworten auf diese Fragen tauchten erst im 19. Jahrhundert auf, als die Physiker begannen, etwas Sichtbares wie das Fallen durch etwas Unsichtbares zu erklären. Die Wissenschaft füllte den Raum mit Feldern an; seitdem befinden sich alle Menschen auf der Erde in ihrem Gravitationsfeld. Das stimmt zwar, wirft aber seinerseits viele neue Fragen auf: Wie kommt denn solch ein Feld zustande? Und wie genau übt es seine Wirkung aus? Wie tritt mein Körper zum Beispiel in Kontakt mit diesem Spannungszustand im Raum? Und kann man dem Zugriff der Schwere entkommen?
Darüber ließe sich eine lange Geschichte erzählen, die wir hier abgekürzt haben, indem wir gleich an ihrem Anfang an das derzeitige Ende gesprungen sind, an dem es Einstein zu seiner und zur allgemeinen Verwunderung fertigbringt, ein Schwerefeld auf die Geometrie der Raumzeit zurückzuführen. Einstein legte in den Jahren des Ersten Weltkriegs dar, daß kosmische Massen wie die Erde oder die Sonne nicht einfach in der Raumzeit herumlungern. Sie machen sich vielmehr in ihr bemerkbar und beeinflussen ihre Geometrie. Konkret ist damit gemeint, daß Materie die Raumzeit so krümmt, wie es zum Beispiel mit einem Dreieck auf einer Kugeloberfläche passiert. Mit diesem Verbiegen kann die moderne Physik exakt das Fallen von schweren und leichten Gegenständen berechnen. Aber auch mit dieser Antwort hat - was sonst? - nur die Zahl der Fragen zugenommen, und das Geheimnis der Gravitation ist sehr viel tiefer geworden. Die Schwerkraft bleibt das Rätsel, das sie immer war, nur steckt es jetzt tief im Kosmos selbst, in seiner Geometrie, von der die Bewegung abhängt.
Läßt die Wissenschaft die alltägliche Welt hinter sich zurück und dringt in Sphären vor, die nur mathematisch zu fassen sind, dann hat der gesunde Menschenverstand so seine Mühe. Das gilt vor allem dann, wenn man sich dem Unendlichen nähert. Dann scheitern viele Menschen an der Frage, wie viele Primzahlen es gibt. Die Folge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, usw. kann man ohne Probleme endlos fortsetzen. Aber wie sieht es mit den Primzahlen aus, die dadurch definiert sind, daß es keinen Teiler für sie gibt? 15 ist keine Primzahl, da sie durch 3 und 5 teilbar ist, aber 17 und 19 sind Primzahlen, weil es keinen Weg gibt, sie durch Division zu zerlegen. Schon früh in der Geschichte der Mathematik tauchte die Frage auf, wie viele Primzahlen es gibt. Denn je größer die Zahlen (Dividenden) werden, desto mehr wächst das Angebot an Divisoren, und irgendwann sollte es doch ausreichen, um eine größte Primzahl entstehen zu lassen, von der ab jede weitere Zahl teilbar ist. So denkt der gesunde Menschenverstand, und schon wieder sieht er dumm aus und liegt falsch. Bereits Euklid konnte im antiken Griechenland beweisen (!), daß es genauso viele Primzahlen wie natürliche Zahlen gibt, nämlich unendlich viele. Wer jetzt an seinem Verstand zweifelt - die Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muß doch insgesamt sehr viel mehr Glieder enthalten als das Äquivalent mit den Primzahlen 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, -, bekommt vielleicht Lust, sich an einer umfassenden «Kritik des gesunden Menschenverstandes» zu versuchen. Der Common Sense führt diejenigen, die nur von ihm Gebrauch machen, leicht in die Irre, wie auch der Sachverhalt zu erkennen gibt, daß Wissenschaft Geheimnisse nicht aufdeckt oder klärt, sondern im Gegenteil das Mysteriöse der Dinge vertieft.
aus: „Warum funkeln die Sterne?“
Die Wunder der Welt wissenschaftlich erklärt
© 2023 C.H. Beck
Veröffentlichung in den Musenblättern mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
|
Vom freien Fall
von Ernst Peter Fischer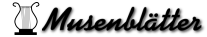

Das Feuilleton
27.07.25
