neue wuTh
„Fräulein Julie“
Andreas Ingenhaag inszeniert August Strindbergs
naturalistisches Trauerspiel in Bodennähe
Mit mancherlei Vorschußlorbeeren und Erwartungen befrachtet, brachte die neue wuTh - kurz nach dem beachtlichen Erfolg mit dem unbekannten Biedermeierstück „Die Veredelung des Menschen“ - nun großen Stoff auf die Bühne, Strindbergs „Programmschrift des Naturalismus“ (H. Uecker) aus dem Jahr 1888. „Fräulein Julie“ ist die Fortsetzung aufklärerischer Dramen mit neuen Mitteln, verbunden mit der Auflösung von Strukturen und Charakteren.
Die kapriziöse Kindfrau Julie (Elizabeth Blonzen), Grafentochter, erwachsen aber unreif und von unerfüllter Liebe enttäuscht, wählt sich Jean, den Diener ihres Vaters (Cornelius Schwalm) für eine unkontrollierte Mittsommernacht zum Objekt ihrer spielerischen Leidenschaft. Es kümmert sie weder der Konflikt Jeans noch der Gram Kristins, der Köchin (Margret Wesemann), der sie den Verlobten damit raubt. Und es kommt, wie es kommen muß: das Unrecht schlägt auf sie zurück.
Verwirrt von Jeans überlegenen Sexualität und männlichen Psyche gibt Julie sich auf und in seine Hand, bereit mit ihm zu fliehen. Sie bestiehlt den Vater, um nach Jeans romantischer Vorstellung Startkapital für ein freies Leben im Ausland zu haben. Nichts als sprühende, verfliegende Gischt. Was bei der morgendlichen Rückkehr des Grafen bleibt, sind Verzweiflung und Schuldgefühle. Niemand kann halten, was in nächtlichen Momenten der Leidenschaft und Gier versprochen wurde. Die Wirklichkeit holt sie augenblicks ein - Jean fällt zurück in die Dienerrolle und überläßt Julie ihrem Schicksal, mehr: er bestärkt sie in der Erkenntnis, sie sei nach den Begriffen ihres Standes ehr- und schutzlos. So fördert er Julies Gedanken an den Tod als Lösung, den sie sich schließlich, von Jean zynisch bestärkt, gibt. Es ist ein Spiel von Macht und Ohnmacht, Euphorie und Sturz in die Verzweiflung, vom vergeblichen Versuch der Überwindung von Vorurteilen und Klassenschranken, dem die Inszenierung nicht im geringsten gerecht werden konnte. Man sieht die düsteren Wolken des Verhängnisses nicht, das Geschehen auf der Bühne bleibt vordergründig, zweidimensional. Die stärksten Momente finden sich noch im Schwung der ersten Bilder, der aber allzu schnell ausrollt. Da sieht man Cornelius Schwalm noch einigermaßen kraftvoll als klassen- und rollenbewußten Diener und witzig-unbeholfenen Weltmann, originellerweise in einer Dompteurjacke als Livree (Kostüme von Birthe Kleine-Beerink), während ihm der Jean später regelrecht (auch textlich) aus dem Ruder läuft und keine Substanz mehr hat. Elizabeth Blonzen ist der vielschichtigen Rolle der Julie nicht gewachsen. Ihr gerät die Tragödie zur Farce, sie kann von Anfang an nicht überzeugen und es wirkt schon peinlich, wie sie Koketterie und Herrschsucht, Höhen und Tiefen überzieht.
Dazu kommt ein nachgerade scheußliches Bühnenbild (Jan Willem Spit), das die Handlung zu mehr als zwei Dritteln auf die Bretter zwingt, will sagen: es wird arg viel auf dem Fußboden herumgesessen und -gelegen. Und wer es nicht gehört hat, kann es nicht glauben, daß Udo Jürgens' „Und immer wieder geht die Sonne auf“ in voller Länge als Themenmusik eingesetzt wurde. Wer kommt auf sowas?
Eine Leistung ragt aus der alles in allem mißlungenen Inszenierung heraus - in souveräner Haltung spielt Margret Wesemann als einziger Nicht-Profi der Aufführung die zurückgesetzte kluge Köchin Kristin glaubhaft und im Kummer anrührend. Sie zeigte Qualitäten die vermuten lassen, daß auch größere Rollen gut bei ihr aufgehoben wären.
Der Titel des Programmheftes erweist sich bedauerlicherweise als im Ergebnis bestätigte Prophezeiung: TRAUERSPIEL ist da zu lesen - wie wahr.
Jean: Cornelius Schwalm – Kristin: Margret Wesemann – Julie: Elisabeth Blonzen
Inszenierung: Andreas Ingenhaag – Bühne: Jan Willem Spit - Kostüme: Birthe Kleine-Beerink
|
Die neue wuTh spielt „Fräulein Julie“
Andreas Ingenhaag inszeniert August Strindbergs naturalistisches Trauerspiel in Bodennähe
von Frank Becker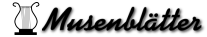

Theater
01.09.96
