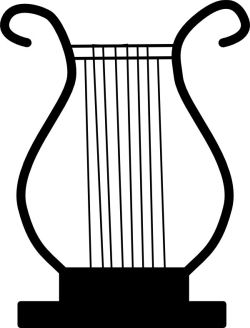Das Schlupfloch zur Freiheit
Karl Otto Mühls späte Prosa und Gedichte
Vortrag, gehalten im Februar 2013 im Rahmen des Symposiums an der
Bergischen Universität zum Werk von Karl Otto Mühl
anläßlich seines Neunzigsten Geburtstages
von Torsten Krug
Als ich vor einigen Jahren zusammen mit einem Freund einen kleinen Musik-Clip für die Oper Gelsenkirchen drehte, war ich auf der Suche nach einem möglichst alten Mann. Dieser sollte als Protagonist dieses Musik-Clips zunächst in ganz alltäglichen Situationen gefilmt, sodann mittels einer Arie aus Manon Lescaut an eine ferne Vergangenheit erinnert werden. Kapazitäten dieser Stadt verwiesen mich für diese Aufgabe an Karl Otto Mühl, dessen knorriger Baß mir schon am Telefon sympathisch war, und der sofort zusagte. Wir könnten den ganzen Tag filmen. Als wir in der vereinbarten Wohnung ankamen - seine Schreibwohnung oder sein „Büro“, wie er sie gerne nennt - waren wir vollkommen verblüfft: kein Locationscout hätte eine solche Wohnung finden, kein Bühnenbildner sie so perfekt nachbauen können, wir traten in eine Wohnung, welche nahezu komplett in den Siebziger Jahren stehengeblieben war. Sie bot das perfekte Umfeld für unsere kleine Geschichte: Ein Mann bleibt nach einer großen Liebe in jungen Jahren allein zurück und lebt ein langes Leben lang weiter, doch er bleibt immer an diese eine große Liebe und die Erinnerungen daran gebunden. Jetzt, beim Erarbeiten dieses Vortrages, mußte ich erneut an diese Konstellation denken.
Wir filmten Karl Otto Mühl also beim Griff in eine Keksdose, beim Tippen am Computer, beim Blick aus dem Fenster, beim Wandeln durch diese wie aus der Zeit gefallenen Räume. Ich traf auf einen Mann, der versonnen vor sich hin brummte, sobald - wie beim Drehen üblich - kleinere Pausen entstanden, zwischendurch zeigte er mir Fotos an den Wänden seines Schreibzimmers - Tankred Dorst, Hanna Jordan, und viele andere, von denen ich nur die Namen kannte, und - ich stutzte - Bilder seiner Töchter, alle drei deutlich jünger als ich. Einmal, als wir ihn schlafend im Bett filmten, schlief er tatsächlich ein, wachte im entscheidenden Moment erfrischt wieder auf und bot uns erneut Nüsse und Äpfel an. Schließlich filmten wir ihn vor dem Badezimmerspiegel beim Hören der Puccini-Arie. Große Nahaufnahmen seines Gesichtes, einer Erinnerungslandschaft gleich.
Dies alles ließ dieser Mann mit einer Seelenruhe geschehen, hatte zwischendurch offensichtlich Freude und Interesse an uns Jungen, stellte immer wieder Fragen nach unserem Leben, unseren Arbeitsmöglichkeiten als Künstler, unseren Familien. Während der zwei Tage, die wir mit ihm und bei ihm drehten, entstand eine gemeinsame, bisweilen beinahe tranceartige Ruhe, und wir vergaßen die Zeit. Seither sind wir Freunde.
Ich habe diese etwas launige Anekdote zum Einstieg erzählt, weil ich merke, daß diese erste Begegnung mit Karl Otto Mühl für mich beinahe alles enthält, was ich wenig später in seinen Texten und vor allem in seiner neuesten Prosa so ausgeprägt wiedergefunden habe. Seither habe ich drei seiner Veröffentlichungen lektorieren und z.T. gestalten können und durfte so sein Schreiben der letzten Jahre begleiten.
2001 überrascht Karl Otto Mühl, der „stille Beobachter“ und „sanftbißige Chronist des Angestelltenlebens“, wie ihn Jörg Aufenanger in seinem Vorwort nennt, mit der Veröffentlichung einer Sammlung von Gedichten, welche Ende der neunziger Jahre entstanden sind. Obwohl Mühl schon als Jugendlicher Gedichte schreibt, mag man diese Veröffentlichung mit dem Titel „Inmitten der Rätsel“ bemerkenswert finden. Ein lyrisches Ich meldet sich da, welches deutlicher, intimer, zugleich rätselhafter von sich selbst erzählen möchte, ja: sich selbst erlebbar machen möchte.
Streng genommen, so bemerkt auch Aufenanger, war es schon immer da, dieses Ich: Fast alle seine Romane - mit Ausnahme vielleicht von „Fernlicht“, seinem einzigen Ausflug in den Bereich des Jugendbuches - folgen der erlebten Wirklichkeit des Kriegsheimkehrers Mühl (in „Siebenschläfer“), des leitenden Angestellten (in „Trumpeners Irrtum“ und in „Hungrige Könige“), der eigenen Kindheit und Jugend im Dritten Reich (in „Nackte Hunde“), der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit (in „Die alten Soldaten“). Immer geht es um dieses Ich, das sich selbst reflektiert, auch und gerade in der Beobachtung und Analyse der anderen. Dennoch scheint hier, mit der ersten größeren Veröffentlichung von Gedichten, ein neuer Raum eröffnet. Ein neuer Ton klingt an, welcher sich 2008 - nach den beiden späten Romanen „Hungrige Könige“ und „Nackte Hunde“ (beide 2005) - in einem weiteren Gedichtband mit dem Titel „Lass uns nie erwachen“ fortsetzt. Mühls späte Prosa, die Bände „Stehcafé“ von 2010 und „Die Erfindung des Augenblicks“ von 2012 (und in gewisser Weise auch seine mittlerweile zwei Aphorismenbände), knüpfen an dieser Entwicklung an. In dieser Prosa sind die lyrische Gestimmtheit und das selbstreflexive Ich nunmehr ständig präsent, ist das Alter Ego, welches jetzt durchweg „Ich“ sagt, kaum oder gar nicht vom Autor Mühl zu unterscheiden.
Seit etlichen Jahren kann man Karl Otto Mühl morgens gegen halb neun in einem winzigen Stehcafé im Domagkweg in Wuppertal antreffen. Kein Wiener Kaffeehaus, nicht einmal eine wirkliche Sitzgelegenheit gibt es, lediglich ein Dreieckstisch in der Ecke bietet einen gewissen Halt in dem kleinen Raum; vor der Theke mit Backwaren findet sich ein schmaler Schlauch mit einigen Stehplätzen. Hier gehen sie ein und aus, die Anwohner der Gegend rund um den Mirker Hain, Handwerker kommen für ihre Pause vorbei, Hundebesitzer, junge Frauen, die im nahen Wald ihre Runden laufen, „Geschiedene“, so Mühl, „Getrennte, Einsame, Singles, Verwitwete, Analphabeten, gefügige Lehrlinge mit ihren Meistern, Gärtner, ein Kraftfahrer, der über seine sechs unehelichen Kinder berichtet“ - und eben auch, angelockt durch Karl Otto Mühl, Schriftstellerkolleginnen und -kollegen, emeritierte Professoren, Politikerwitwen, Künstler oder Lehrer. Es ist ein perfekter Ort für den Autor Karl Otto Mühl, ein Menschenpark, ein Umschlagplatz für kleine und große Schicksale, für Informationen, Gerüchte, Halbwissen und scheinbar Unbedeutendes. Jedes Gesicht, jede fremde Erscheinung läßt Schicksale erahnen oder erfinden. Hier findet Mühl, was er sucht und braucht, entfaltet sich seine Gabe zur genauen Beobachtung und befriedigt sich seine Neugier. Alles kann hier zum Anlaß werden für eine philosophische Reflexion, eine Einsicht, eine Erkenntnis oder auch: eine persönliche Erinnerung. Ganz nahe an diesem Stehcafé, das einfacher und bescheidener nicht sein könnte, liegt der Wald des Mirker Hain, der mindestens ebenso bedeutend für das Szenario dieser späten Prosa ist. Die Natur spricht auch, wenn die Menschen schweigen, und bildet eine „Sinfonie lautloser Ereignisse“, wie es in dem kurzen Text „Donnerstagmorgen mit einem Zufriedenen“ heißt:
„Wieder ein regennasser Morgen. Andere Läufer und Geher scheinen heute wenig Lust zu haben. Die Waldwege sind menschenleer; bis zum Ende der Strecke, von wo sich die bunten Gestalten sonst, langsam größer werdend, nähern, ist niemand zu sehen.
Dafür spricht der Wald umso mächtiger und deutlicher zu mir, fast scheint es, als richteten sich die Bäume jäh vor mir auf und lächelten dann gutmütig, weil sie mich erschreckt haben. Die Luft ist feuchtkalt. Es ist ja Herbst mit einer Prise Winter darin. Rechts am Wegrand liegt ein großer Stapel dicker, gefällter Stämme, krumme und gerade übereinander getürmt. Die hellbraunen Schnittflächen leuchten, die gestürzten Riesen türmen sich wie gigantische Muskelpakete, noch immer bersten sie vor Kraft. Ich weiß nicht, wo ich in dieser Sinfonie der lautlosen Ereignisse zuerst hinschauen soll.“ (Aus: Stehcafé) Durch dieses Szenario - das Stehcafé als Sinnbild einer Gesellschaft, umgeben von der belebten Natur - mäandert das Alter Ego dieser späten Prosa. Man kann sie kaum Geschichten oder Erzählungen nennen, eher Reflexionen, Beobachtungen, Miniaturen oder auch Meditationen.
„Man schreibt, um sich selbst erlebbar zu machen“, lautet eine frühe Selbstaussage Mühls. Die Bäckerei und der Wald werden zu den Orten dieser Bemühung:
„Heute ist Montag. Ein ganz anderes Gefühl habe ich heute; kein Vergleich zu gestern morgen, als ich auch durch den Wald lief. Sonntags besteht ja immer die Gefahr, daß ich von der Welt vergessen werde.
An Sonntagen bemerkt sie mich nicht, die Welt, ob sie nun im Sonnenlicht schweigt oder ob sie unter Regengüssen versinkt oder den Morgennebel wie eine Decke über den Kopf zieht. Erst in der Bäckerei werde ich schließlich bemerkt.“ (aus: „Stehcafé“) Oft werden Geschichten nur angedeutet, selten wird eine wirkliche Handlung, ein Ereignis zu Ende erzählt, sondern im Gegenteil: hinter jeder Biegung leuchten die zahllosen anderen Lebensmöglichkeiten hervor, und hinter jedem Satz stehen unzählige andere, welche den soeben gesagten ins Unendliche vertiefen. Es ist diese Vielstimmigkeit, diese Verschachtelung von ganz heterogener Ebenen, welche diese späte Prosa zu einem originären literarischen Genre machen.
Literarische Vorbilder hierzu finden sich am ehesten in der Romantik. „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn“, heißt es in der wohl prägnantesten Definition des Romantischen bei Novalis, „dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ In diesem Sinne läßt sich Mühls späte Prosa lesen als ein lyrisch gestimmter, tagebuchartiger Bericht und zum Teil eine Überhöhung des Alltäglichen. „Der romantische Geist“, schreibt Rüdiger Safranski in seinem Buch über die Romantik, „ist vielgestaltig, musikalisch, versuchend und versucherisch, er liebt die Ferne der Zukunft und der Vergangenheit, die Überraschungen im Alltäglichen, die Extreme, das Unbewußte, den Traum, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion. Der romantische Geist bleibt sich nicht gleich, ist verwandelnd und widersprüchlich, sehnsüchtig und zynisch, ins Unverständliche vernarrt und volkstümlich, ironisch und schwärmerisch, selbstverliebt und gesellig (...)“ (Aus: „Romantik. Eine deutsche Affäre“). All dies läßt sich in Mühls später Prosa finden.
Ein Bericht von einem Elektrotechniker, der seinen Kunden nur noch so viel abverlangt, wie sie zu zahlen bereit sind, gerät dem Autor zum Märchen, was er auch umgehend selbst reflektiert:
„Ich merke jetzt, daß ich diese Geschichte wie ein Märchen erzählt habe. Man kann ja auch heiter und beschwingt dabei werden, alles vergessen. Ich zum Beispiel meinen Onkel Karl, der bei Kriegsende in Rumänien als Gefangener in einem Schuppen lag, mit einem Sack zugedeckt, und endlich sterben durfte; ich denke an Krankheiten und an die Geschwindigkeit, mit der wir durch das Leben getrieben werden. Und daß ich immer denken muß: Irgendwann sehe ich den oder die nicht wieder.
Oder anders: Daß die Wirklichkeit hinter meinem Bericht viele Schichten hat, und daß durch alle geschehenen Fakten hindurch Kräfte wirken, die wir nicht sehen (...); es erklingen Melodien, die wir nicht hören. (...) Eigentlich suchen wir aber das Schlupfloch zur Freiheit.“ (aus: „Die Erfindung des Augenblicks“) Diese Musik hinter den Dingen, diese Melodien hinter der Melodie sind auch dem Trauma der Generation des Autors geschuldet: Als Kriegsheimkehrer gehört er zu denen, die überlebten. Ein „Rätsel“ mithin seither schon die Frage, warum man noch lebt und ein anderer nicht. Das „Schlupfloch zur Freiheit“ hieße ein Ankommen, ein Moderieren der unerträglich aufeinander prallenden Empfindungen. „Inmitten der Rätsel“ enthält ein Gedicht mit dem Titel „Das Unerträgliche“:
Eigentlich könnt ich
nur leben wenn ich die Hölle vergäße in der andere sind vielleicht morgen ich Sie rufen und strecken die Hände empor Ich lebe trotzdem ich glaube die Musik ist zu laut Wenn die Musik zu laut ist, wenn die Melodien hinter den Dingen, die Erinnerungen an Unfassbares oder die Vorahnung von Unfassbarem, zu laut werden, ist das Leben unerträglich. Dieser Umstand erfordert Widerstand, Lebenswille und die Lust, kleine Dinge zu beachten, sie in den Rang einer unerhörten Begebenheit zu erheben, kurz: seine eigene Melodie zu singen.
Das lyrische Ich braucht Ermutigung, holt sie sich beim ersten Blick in die Zeitung:
Der Morgen
fängt gut an. Ich lese die Todesanzeigen, und ich bin nicht dabei. Die Tatkraft, das Knorrige, Selbstbewußte, und der Humor bilden das Gegengewicht zur romantischen Auflösung oder Vertiefung; die alltägliche Organisation, das „Erledigen“ wird zum „Tagewerk“, wie es in einem der Texte heißt. Und doch ist die Vergänglichkeit, die eigene inbegriffen, fast immer präsent. „Der Herbst“, heißt es zu Beginn einer Aufzeichnung aus dem ersten Stehcafé-Band, „ist mein Nachbar geworden“:
„Nachts weckt er mich auf mit tosenden Windböen, mit Blitz und Donner, morgens verstellt er das Außenthermometer auf unvorstellbare sechs Grad, vor der Haustüre ragt mir sein braunes, nasses Gesicht entgegen. Er reißt mir den Wunsch nach Promenadenfröhlichkeit und Leichtfertigkeit aus der Hand, er erinnert unbarmherzig daran, wie rasch die letzten zehn und mehr Jahre vergangen sind, und, schreit er, das sollte mit den letzten paar Jahren nicht auch so gehen?“ (aus: „Stehcafé“)
Auch hier sind die Naturbilder metaphorisch aufgeladen, steht der Jahreskreislauf für den Lauf des Lebens. „Der Herbst räumt sie weg, die alten Freunde“, heißt es am Ende desselben Textes. Und: „Wohin immer ich jetzt gehen werde, es wird nur vorläufig sein“.
Dieses Bewußtsein für die eigene Endlichkeit ist, wie gesagt, nicht neu für den kriegserfahrenen Mühl. Ein Gedicht aus dem Band „Inmitten der Rätsel“ berichtet von einer Einsicht des jungen Mannes:
Kriegsgefangenentransport
Führ er doch schon zurück,
unser eiserner Wurm! Unsere Köpfe wackeln im Takt. Durch verstepptes Land,
wie eine karge Glatze bewachsen, donnert unser gestohlenes Leben. In jeder Kurve drängt in uns hoch, daß wir gedankenlos waren. Wir schmissen es weg, das Leben, das uns liebte. Dieses „gestohlene Leben“ ist durchaus mehrdeutig: Zum einen meint es ein Leben, daß in die Hände der Feinde gefallen und insofern gestohlen ist; zum anderen war es schon vorher gestohlen - und das wird dem lyrischen Ich nun klar: es sind die gestohlenen Jahre der Jugend und des jungen Mann-Seins einer ganzen Generation. Doch rückblickend hat dieses „gestohlen“ noch eine dritte Konnotation: Karl Otto Mühl wird nicht müde zu betonen, daß die Kriegsgefangenschaft und damit der frühe Austritt aus den Kriegshandlungen sein größtes Glück und seine Rettung waren. Und so lebt er in gewisser Weise dieses gestohlene Leben fort, während es zahllosen anderen, darunter Freunden, genommen wurde. Das gestohlene ist auch ein geschenktes Leben.
Dieses memento mori, welches seine späten Texte wie ein roter Faden durchzieht, führt jedoch nicht oder selten zu einer Schwere, einer Verdunklung bis hin zu Düsternis, sondern es erscheint aufgefangen oder sublimiert durch einer Form der Romantischen Ironie. Diese bedeutet, so schreibt Friedrich Schlegel um 1800, „im ursprünglich Sokratischen Sinn (...) eben nichts andres, als das Erstaunen des denkenden Geistes über sich selbst, was sich oft in leises Lächeln auflöst“. Dabei könne sich, so Schlegel, infolge der Selbstdistanz durchaus das Gefühl von Komik einstellen - verstanden als eine wichtige Vorraussetzung für eine „höher liegende Ernsthaftigkeit“.
Einen letzten bemerkenswerten Aspekt dieser späten Prosa möchte ich noch herausheben. Sowohl die beinahe ständige thematische Präsenz der Vergänglichkeit als auch die lyrische Gestimmtheit in diesen Texten führen nicht selten zu einer erzählerischen Verdichtung auf einen Augenblick hin.
Schon im Gedichtband „Inmitten der Rätsel“ sind das Erleben des Augenblicks und die Unmöglichkeit, ihn in Worte zu fassen, Thema:
Rätsel
Da hat ein Gesicht durch die Tür gespäht; nur einen Spalt, dann ging sie zu. Voll solcher stummer Augenblicke ist mein Leben. Sie sagen niemals, wer sie sind. Hör hin, wenn Glas zerspringt, sieh zu, wenn Efeu erschauert. Sie sagen die Wahrheit, beide. Beide sagen die Wahrheit. „Die Wahrheit“ ist mithin etwas, an das die Sprache nicht reicht, die Wahrheit ist ein Rätsel. Und so nähert sich Mühls späte Prosa immer wieder einem solchen Augenblick, umkreist ihn, erinnert ihn, versucht ihn zu fassen, doch es ist immer ein „Danach“ und in diesem Sinne eine „Erfindung des Augenblicks“.
In einem kurzen Text aus dem gleichnamigen Prosaband überquert das Alter Ego Mühls eine Straße, „in einigen hundert Metern Entfernung werden Autos sichtbar“, heißt es, „Zeit ist aber noch genug“.
„Da passiert etwas. Der Asphalt hat Risse, und ich stolpere, kurz bevor ich die andere Straßenseite erreiche. Mit einer Hand fange ich den Sturz ein wenig ab, doch spüre ich, wie ich über den rauen Asphalt schramme. Für Sekunden muß ich nichts gedacht, gespürt oder gefühlt haben. Dies war ein seliger Augenblick mit dem Gefühl des Nichtseins.
Ich erinnere mich heute, es war, als ob sich ein Vorhang nach beiden Seiten öffnete, Luft und Licht wurden dünn und blass, aber dennoch überglänzt. Es war nichts mehr vorhanden, nicht einmal ich, aber dennoch gab es mich und alle, die ich kenne, es gab die Freunde, die toten und die lebendigen; keiner zu sehen, aber jeder gegenwärtig als Idee seiner selbst. Nichts war zu sehen, aber alles voller Freundlichkeit vorhanden und ich mitten darin. Ein Auto bremst einige Meter vor mir. In diesem Augenblick rolle ich mich aber bereits zum Bürgersteig hin, stehe auf und klopfe den Staub ab.“ (aus „Die Erfindung des Augenblicks“) „Was bleibt“, fragt sich der Erzähler an anderer Stelle, „wenn sich herausstellt, daß es Vergangenheit und Zukunft real gar nicht gibt? Was sind wir dann?“ Nicht nur der Asphalt, sondern die Realität hat Risse. In ihnen - Heidegger würde sagen: im Ereignis, im Nicht Ableitbaren - offenbart sich unsere Existenz.
Und so gerät diese späte Prosa - und auch manch spätes Gedicht - an ihren glücklichsten Stellen in eine ganz eigene Art des Schwebens zwischen Oberfläche und Tiefe, zwischen schalkhaftem Witz und empfundener Tragik, zwischen knorriger Alltagsbeschreibung und philosophischer Reflexion. Die Romantische Ironie bietet hierbei ein „Schlupfloch zur Freiheit“, eine Möglichkeit, zwischen umfassenderen Sinnstiftungen einerseits und alltäglich auszuhaltenden, meist banalen oder auch frustrierenden Lebensumständen andererseits im aktuellen Hier und Jetzt zu vermitteln.
Karl Otto Mühls literarische Produktivität ist ungebrochen. Wöchentlich, manchmal täglich erreichen seine Freunde E-Mails mit Texten - Fragmente zumeist, Anfänge oder Augenblicke, kleine Szenen, tagebuchartig, skizzenhaft eingefangen; „zu einem Roman“, sagte er einmal zu mir, „spüre ich nicht die Kraft“. Ein neues, noch unvollendetes Manuskript trägt den Arbeitstitel „Mein Leben als Greis“. Es beginnt mit dem durchaus ironischen Satz: „Vielleicht ist dies mein letztes Buch. Schonungslos werde ich die Wahrheit sagen, über alles und jeden, ausgenommen mich selbst.“
Ganz in diesem Sinne möchte ich mit einem Gedicht enden, das auch uns Junge mit einbezieht:
An die Alten
Nur alte Säcke ringsumher,
silbernes Haar, Freskengesicht, knochiger Hintern, schlaffe Haut, ausgestreut wie Abfall am Rand des Lebens. Wehrt euch, ihr grauen Dämmergestalten, wehrt euch. Nicht mit Krähen und Keifen, aber mit deutlichem Blick, mit stillem Schlurfen ins Dunkel, mit lichten Gedanken und Freundlichkeit. Seht nur, wie die Jungen da schmatzend vorüberziehn, und neidisch schaun sie auf euch. Torsten Krug ist Theaterregisseur, Musiker und Autor. Er lebt seit 2006 in Wuppertal. Nähere Informationen unter: www.torsten-krug.de .
|


Literatur
26.02.13